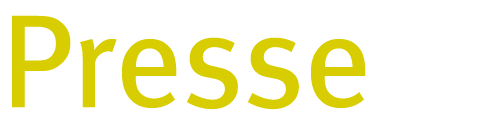
Die Gegenwart herrscht nicht über die Zeit
Fünfteilige ARD-Reihe zum Ersten Weltkrieg
FAZ, 2.8.2004
Im August, in einem einzigen Monat, wird vor unseren Augen nicht allein der Erste Weltkrieg, sondern eine ganze Epoche des Umbruchs abgespult. Was für einen merkwürdigen Eindruck müßte dieser Umstand auf jemanden machen, der die Kriegszeit Tag für Tag erlebt hat - und welchen Unterschied. Diese zusammengedrängte, gestauchte Vergangenheit hat etwas traumartiges, irreales und war doch einmal blutige Wirklichkeit, aus der man nirgendswohin wegzappen konnte.
Würde es nur einmal gelingen, unsere eigene Gegenwart so zu sehen, wie wir die Vergangenheit betrachten, dann fiele wenigstens auf, wie unfrei man jederzeit ist - trotz aller Freiheiten und vieler Möglichkeiten. Sowenig wie die Menschen des Ersten Weltkriegs, sowenig können auch wir aus unserer Zeit. Das scheint banal, und doch tut jede Gegenwart so, als sei sie die Herrscherin über die Zeit, als sie sie ihr Gipfel, obwohl sie am Ende ebenso in den Abgrund der Vergangenheit rutscht.
Gefangen in der Zeit
Um so größer ist die Leistung einer exzellenten Serie zum Ersten Weltkrieg, die in den nächsten Wochen in der ARD läuft. Denn sie vermag beides zu zeigen: die totale Gefangenschaft in der Zeit, ihren Ereignissen und Umständen, aber auch den Versuch, sich aus seiner Zeit und ihren Fatalitäten, eingebildeten oder wirklichen Zwängen, ihrem Wahn und ihrer Vernunft zu befreien. Mit anderen Worten: Sie zeigt den Menschen als Geschichtswesen und bringt uns damit eine Erfahrung nahe, die die Deutschen der Bundesrepublik lange nicht mehr kennen. Der Fall der Mauer dürfte der vorerst letzte Fall dieser historischen Erfahrung gewesen sein - und auch sie griff in das Leben der meisten kaum nachhaltig ein, ganz im Gegensatz zu den Bürgern der DDR. Wenn eine bleibende Fremdheit zwischen beiden Teilen Deutschlands festgestellt wird, dann hat es vielleicht auch damit zu tun, daß die einen Geschichte sahen und die anderen sie erlebten.
Begeben wir uns also in eine Zeit, die sich selbst als Höhepunkt aller menschlichen Entwicklungstendenzen verstand, als Höhepunkt von Technik, Wissenschaft und Kultur - und die an diesem Glauben auch noch festhielt, als sie alle ihre Resourcen nur noch für den einen Zweck gebrauchen wollte, die andere Seite so gründlich und entscheidend wie möglich zu vernichten.
Die neue Waffe: Chemie
Gas - dieses Wort, das später zum Synonym für totale, unpersönliche Vernichtung stehen sollte, begann seine traurige Karriere als Schreckenswort in den Gräben des Ersten Weltkriegs. "Die Gashölle Ypern", ein Film von Heinrich Billstein, entwickelt sehr deutlich die Logik, mit der sich die Wissenschaft der irren Logik des Krieges unterwarf. Als im Herbst 1914 die Fronten sich festgelaufen hatten und die Heere buchstäblich in der Erde versanken, um sich wenigstens zu schützen, wenn sie schon nicht mehr angreifen konnten, kam die Stunde der neuen Waffe: Chemie.
Deutschland war schon gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Nation mit der am weitesten entwickelten chemischen Industrie, und die Totalität des Krieges, die vom August 1914 an in den Köpfen nicht nur als ausgemacht, sondern als gerechtfertigt und notwendig galt, erfaßte nun auch die chemischen Institute an den Universitäten und die großen Chemiehersteller wie Bayer und Hoechst. Zwar hatte die Haager Landkriegsordnung von 1907 den Einsatz chemischer Waffen bereits verboten, aber nun, in dieser Situation, kümmerte man sich nicht mehr um die Verträge, die man unterschrieben hatte. Wie nur konnte man den mörderischen Stillstand der Front überwinden? Wenn man es nicht mit mehr Infanterie und nicht mit mehr Artillerie schaffte, dann vielleicht mit einer neuen Waffe, die leise und schleichend den Feind vernichten sollte.
Chlorgas als Kampfmittel
Eine überragende Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung des Gaskrieges spielte der Chemiker Fritz Haber. Er leitete das kurz zuvor gegründete Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie in Berlin und entwickelte nun Chlorgas als Kampfmittel, zunächst für den belgischen Frontabschnitt bei Ypern. Es wurden zahlreiche Versuche unternommen im offenen Gelände, bei Köln und Berlin, und an Tieren. Man erprobte die Reaktion der zuschauenden Wissenschaftler auf den qualvollen Erstickungstod.
Dann, am 22. April, bei günstigem Wind, setzen die Deutschen Gaswolken frei, die langsam auf die alliierten Gräben zutreiben und dort dann eine verheerende Wirkung ausüben. Der Film führt nicht allein in die Hölle der erblindeten Soldaten, in die Lazarette, in denen die Soldaten sich nach und nach die verätzten Lungen aushusten und qualvoll sterben. Vielmehr läßt er auch anhand von Interviews, zumal mit der Enkelin von Haber, etwas vom Selbstverständnis der Handelnden klarwerden. Es spricht nicht gerade für die strategische Qualität der deutschen Heeresführung, daß sie für den Fall eines erfolgreichen Einsatzes keine hinreichenden Vorbereitungen für ein massives Nachsetzen getroffen hatte. So verpuffte der Überraschungseffekt - und im September des gleichen Jahres revanchierten sich dann die Engländer bei Loos mit über dreihundert Gasattacken.
Erfinder der chemischen Waffe erhielt Nobelpreis
Ob Monarchie oder Demokratie - beim Gaseinsatz gab es auf keiner Seite Skrupel. Sich das in Erinnerung zu rufen ist nützlich, um vor der Illusion einer Unschuldsgarantie von Demokratien gefeit zu sein. Heinrich Billstein hätte noch erwähnen können, daß Fritz Haber kaum ein Jahr nach Ende des Weltkriegs dann den Nobelpreis für die Ammoniaksynthese erhielt - eine Auszeichnung, die viel über den Geist der Zeit und die Selbstverständlichkeit der Bedenkenlosigkeit sagt.
Eine ähnliche Bedenkenlosigkeit zeigt auch der "Albtraum Verdun" von Werner Biermann und Mathias Haentjes. In eindringlichen Bildern, die man nicht so leicht vergißt, zeigt er, wie die "Blutmühle Frankreichs" zu einem apokalyptischen Aberwitz sich entwickelt, der am Ende für die Franzosen zum Symbol des alles vermögenden Widerstandswillens wird, für die Deutschen aber zum Zeichen eines falschen Kalküls: Die Franzosen waren nämlich ebenso entschlossen wie die Deutschen selbst. Verdun und das Fort Douaumont wurden durch Ernst Jünger und andere auch zu einem literarischen Ort einer Moderne des heroischen Schreckens und neuen Menschens. Eine folgenreiche Nachgeschichte, die eine ganze Generation nach dem Weltkrieg noch prägen und in ihrer Haltung inspirieren sollte. Der industriellen Wucht die Schrankenlosigkeit des eigenen Willens und der überlegenen Anpassung gegenüberstellen - das sollte eine bleibende Selbststilisierung und Propagandafigur der Nachkriegszeit werden.
Ein neues Schlachtfeld entsteht - in der Heimat
Die Nachkriegszeit verfügte bereits über reiche Erfahrung in der Technik der Mobilisierung, der geistigen und physischen Erfassung der Menschen. Schließlich gab es nicht nur Front und Etappe, es gab auch die Heimatfront, das "Schlachtfeld Heimat", wie der bemerkenswerte Film von Anne Roehrkohl heißt. Er zeigt die buchstäblich vernagelten Götzen des Durchhaltens, die zwölf Meter hohe Holzfigur Hindenburgs, in die in Berlin für Spendengelder Nägel eingeschlagen werden, er erzählt, wie zu Beginn des Krieges jede gewonnene Schlacht für die Schüler einen schulfreien Tag bedeutete, bis irgendwann der Hunger regierte und die Steckrübe, wie eine Welt voller zentralistischer Verordnungen der bürgerlichen Welt und ihrem Enthusiasmus der Freiwilligkeit den Garaus bereiteten.
Anne Roerkohl versteht die allmähliche Entstehung dieses neuen Schlachtfelds. Anhand eines Briefwechsels zweier Eheleute während des Krieges und der Fotografien der Braunschweigerin Käthe Buchler bringt sie dem Zuschauer die Verzweiflung der Mütter und Frauen nahe, die als "Kanarienvögel" schufteten, wie die Engländer die Rüstungsarbeiterinnen wegen ihren gelben Hände nannten, und dabei häufig ihre Gesundheit ruinierten. Wir hören die sarkastischen Reime bei den Arbeitern, die sich wie eine Moritat zum Krieg ausnehmen: "Die Armen liefern die Leichen,/Der Mittelstand muß weichen,/Den Krieg gewinnen die Reichen." In dieser großartigen Serie kommt leider die Erfahrung der Ostfront zu kurz: Sie enthält Lektionen, deren Modernität atemberaubend ist.
MICHAEL JEISMANN
I